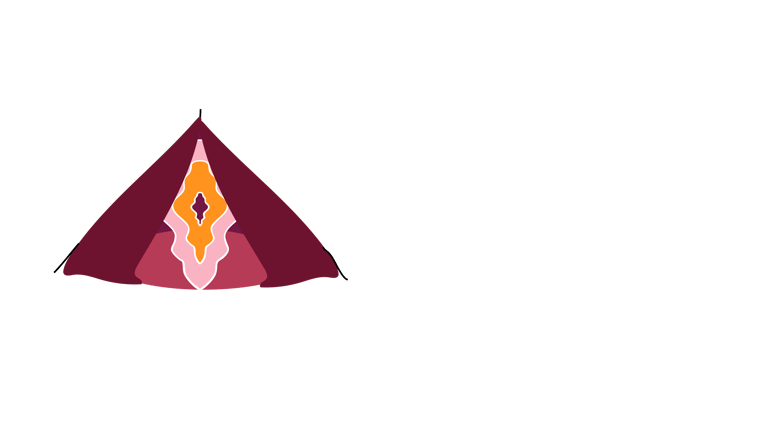Burlesque: Glitzer, Rebellion & die Frage, wem die Bühne gehört
Burlesque begann als Widerstand gegen Macht – und wurde zur Ware weißer Schönheitsideale. Heute stellt sich die Frage neu: Welche Körper werden sichtbar, welche nicht? Ein dekolonialer Blick auf Glitzer, Geschichte und Körperpolitik.
Lea Neumeyer
12/1/20253 min read


Wenn ich und wahrscheinlich viele andere heute an Burlesque denken, tauchen sofort Bilder auf: Glitzer, Federn, Kostüme, ein bestimmter Körper, der sich selbstbewusst entblättert, ein nostalgisches Echo der 20er bis 50er Jahre. Vielleicht auch an Christina Aguilera und Cher im Film Burlesque. Doch das ist nur ein schmaler Ausschnitt dessen, was Burlesque einmal war – und vielleicht wieder sein könnte.
Burlesque begann nicht als Erotikspektakel, sondern als bissige Satire. Es machte sich lustig über jene, die gesellschaftliche Macht hatten: Könige, Kirche, Aristokratie, Kultur-Eliten. Nichts war heilig. Alles konnte zur Parodie werden. Burlesque war ein Ort, an dem die Welt auf den Kopf gestellt wurde, an dem sich gewöhnliche Menschen über jene lustig machten, die ihnen Vorschriften machten. Es war ungehorsam, verspielt, politisch – und ja, auch sinnlich, aber nie im Sinne von „perfekt“ oder „normschön“.
Die verdrängte Geschichte Schwarzer Performer*innen
In den USA entwickelte sich Burlesque nicht im luftleeren Raum. Parallel dazu existierten afroamerikanische Performance-Traditionen, ohne die die Ästhetik, der Rhythmus und die gesamte Körperlichkeit der späteren Burlesque-Szene undenkbar wären: Vaudeville-Ensembles, Blues-Performances, Shake-Dancerinnen, frühe queere Bühnen der Harlem Renaissance. Dort entstanden Formen von erotischer Selbstbestimmung, Humor und Camp*, die radikaler waren als vieles, was der weiße Mainstream zeigte.
* „Camp“ bezeichnet eine queere Ästhetik der Übertreibung – bewusst künstlich, verspielt, dramatisch und „too much“. Es macht Spaß daraus, nicht natürlich wirken zu wollen.
Doch wie so oft in der US-amerikanischen Kulturgeschichte wurden die Schwarze Wurzeln dieser Kunstform entweder ignoriert oder exotisiert. Weiße Produzenten übernahmen das, was profitabel war, und schoben Schwarze Künstler*innen an den Rand. Burlesque wurde „weiß“ – ästhetisch, wirtschaftlich, narrativ. Die Körper, die gefeiert wurden, waren diejenigen, die zum Schönheitsideal der weißen Mehrheitsgesellschaft passten. Die anderen blieben unsichtbar oder wurden als „anders“ markiert.
Vom Widerstand zur Ware
Mit der Kommerzialisierung des amerikanischen Burlesque im frühen 20. Jahrhundert verschob sich der Fokus. Aus Satire wurde Unterhaltung. Aus Gesellschaftskritik wurde Glamour. Aus komplexen Körpern wurden „Showgirls“. Erotik wurde verkauft, aber nur in der Form, die das heterosexuelle, weiße, männliche Publikum als reizvoll definierte.
Was einst eine Parodie auf Macht war, wurde zum Produkt eines neuen Marktes. Und wie jeder Markt bevorzugte er bestimmte Körper: jung, weiß, normschön, ohne Behinderung, "feminin" nach heteronormativen Vorstellungen. Viele Körper waren schlicht nicht vorgesehen. Nicht, weil sie nicht existierten – sondern weil sie nicht als „verkaufbar“ galten.
Das Revival – und seine Grenzen
Als Burlesque in den 1990er Jahren zurückkehrte, tat es das unter völlig anderen Vorzeichen. Neo-Burlesque brachte Queerness zurück ins Zentrum. Dicke Körper, Tattoos, Körperbehaarung, Geschlechterfluidität, Prothesen, Rollstühle, Narben, Behinderungen – all das wurde plötzlich sichtbar, gefeiert, bewohnt. Die Bühnen wurden politischer, experimenteller, vielfältiger.
Und gleichzeitig blieb der Westen nicht von seiner eigenen Ideologie unberührt. In einer kapitalistischen Welt wird selbst Befreiung gern zur Marke. Burlesque wird heute oft als Empowerment-Tool verkauft: „Lerne deinen Körper zu lieben“, „Strip your shame away“, „Entfalte die Göttin in dir“. Das klingt wunderschön – und ist es für manche Menschen auch.
Aber Empowerment ist kein Konsumprodukt.
Es ist auch keine individuelle Leistung.
Nicht alle Menschen können sich sicher auf einer Bühne bewegen. Nicht alle haben Zugang zu Räumen, in denen sie nicht diskriminiert werden. Nicht alle können überhaupt sichtbar sein – aus ökonomischen, rassistischen, transfeindlichen oder sicherheitsbezogenen Gründen.
„Empower dich doch selbst“ funktioniert nur für Menschen, die bereits ein Mindestmaß an Sicherheit haben.
Für wen ist Burlesque eigentlich ein Zuhause?
Das ist die Frage, die bleibt. Und die wir ehrlich stellen müssen.
Welche Körper dürfen „sinnlich“ sein, ohne Gefahr zu laufen, sexualisiert, kriminalisiert oder exotisiert zu werden?
Welche Körper gelten als Kunst – und welche als „zu viel“?
Wer hat Zugriff auf Bühnen?
Wer kann Kostüme bezahlen, Zeit investieren, Communities finden?
Wer hat Barrierefreiheit? Wer Awareness? Wer Schutz?
Burlesque hat das Potenzial, einer der radikalsten Räume für Körpervielfalt zu sein.
Und oft ist es das tatsächlich.
Aber es ist kein naturgegeben sicherer Ort – er wird erst dann sicher, wenn wir ihn bewusst dazu machen.
Burlesque dekolonisieren heißt:
die ursprüngliche Rebellion zurückholen.
Es heißt, Schwarze und indigene Performer*innen nicht nur als „historische Fußnote“, sondern als zentrales Fundament anzuerkennen.
Es heißt, queere und trans Körper nicht nur mitzudenken, sondern sichtbar zu machen, zu feiern, ihnen Räume zu geben.
Es heißt, Behinderung nicht als Hindernis, sondern als Ästhetik zu begreifen.
Es heißt, Erotik nicht für den Konsum zu produzieren, sondern für die Selbstbestimmung.
Burlesque war nie nur Glitzer.
Es war ein Werkzeug der Lächerlichkeit gegen die Macht.
Die Frage ist:
Wagen wir das heute noch?
© 2025. All rights reserved.
*juicy NEWSLETTER
HOLE DIR UNSEREN
Du möchtest R.E.D. Tent zunächst besser kennenlernen?
1x Willkommens-Freebie:
Meditation: „Schärfe deine Wahrnehmung für feine Körpersignale"Impulse zu Körperwissen & Selbstermächtigung
Infos zu Kursen, Webinaren & Events
Persönliche Gedanken & ehrliche Fragen
Und was uns gerade bewegt und inspiriert
und erhalte:
*juicy = Der Begriff kommt aus afro-diasporischen Communities und steht für Sinnlichkeit und Fülle – eine Einladung, Körperfreude jenseits von Leistungslogik zu leben.