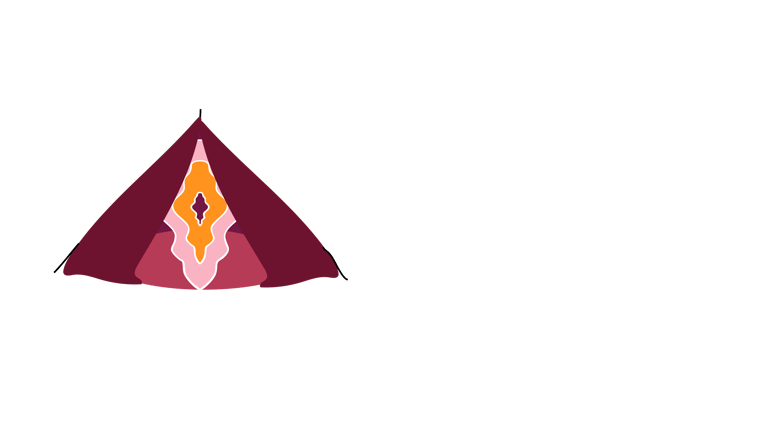Glatt, sauber, zivilisiert? – Die koloniale Geschichte der Haarentfernung
Haarentfernung ist nie neutral. Sie erzählt Geschichten von Macht, Kontrolle und Befreiung – und davon, wie wir unsere Körper zurückerobern.
Lea Neumeyer
10/14/20253 min read


Ich rasiere mir die Beine nicht. Kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann ich es das letzte Mal gemacht habe. 12 Jahre…länger her? Ich mag es, meine Vulvahaare zu stutzen – manchmal kürzer, manchmal voller. Gestutzt bin ich empfindlicher, werde schon von leichten Berührungen erregt. Da smag ich. Und meine Achselhaare trimme ich, einfach weil ich es angenehm finde. Manchmal all cut - wie nen Freshness-Reset.
Trotzdem bin ich nicht frei von Schönheitsidealen. Ich merke, wie sich manchmal ein stilles Urteil in mir regt, wenn ich meine Beinhaare sehe – dass sie „wild“ aussehen, „ungepflegt“, „zu viel“. Und ich frage mich: Woher kommt dieses Empfinden? Wem gehört diese Stimme in mir?
Wenn wir über Körperhaare sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Ästhetik – wir sprechen über Macht, Geschichte und Kontrolle.
Rebecca Herzig schreibt in ihrem Buch Plucked: A History of Hair Removal:
„Hairlessness was never just about beauty — it was about proving one’s humanity, civility, and fitness for citizenship.“
Haarlosigkeit war nie nur ein Schönheitsideal.
Sie war ein Zeichen dafür, wer als „zivilisiert“ galt – und wer nicht.
Vom Kolonialismus zur Körpernorm
Im 19. Jahrhundert wurde Körperbehaarung zu einem moralischen, wissenschaftlichen und politischen Thema. Europäische Anthropolog*innen, Mediziner*innen und Sexualforscher*innen (Obwohl es meistens männlich sozialisierte Personen waren, also frage ich mich, ob das Sternchen hier überhaupt angebracht ist) erklärten glatte, helle Haut zum Zeichen von „Fortschritt“ und „Kontrolle“ – und starke Körperbehaarung zum Beweis für „Rückständigkeit“ und „Triebhaftigkeit“.
Die Haut weißer FLINTA wurde zum Maßstab der Zivilisation. Und Behaarung – vor allem an weiblich gelesenen Körpern – wurde zum Symbol des „Unreinen“, „Animalischen“, „Unkontrollierten“.
In kolonialen Kontexten wurden Schwarze, indigene und braune Körper als „zu behaart“, „zu körperlich“, „zu triebhaft“ dargestellt. Haarentfernung wurde damit zum Zivilisationsakt – eine symbolische Grenze zwischen „uns“ und „den Anderen“. WTF! Darum waren weiße FLINTA in der Kolonialisierung nicht passiv, sondern haben ebenfalls aktiv dazu beigetragen.
Während weiße Frauen* im 19. Jahrhundert zunehmend als „reine, disziplinierte Wesen“ konstruiert wurden, wurde die Kontrolle über den Körper zu einem moralischen Gebot.
Glätte bedeutete Tugend. Behaarung bedeutete Nachlässigkeit.
Als im frühen 20. Jahrhundert Rasierfirmen wie Gillette, Schick oder Veet aufkamen, griffen sie genau diese koloniale Erzählung auf – verpackt in Pastellfarben und Werbung.
Frauen wurden darauf trainiert, Haarentfernung als „Pflege“, „Sauberkeit“ und „Weiblichkeit“ zu verstehen. Und die Industrie machte Milliarden mit dem Versprechen, „modern“ zu sein.
Weißsein, Wohlstand und Weiblichkeit verschmolzen zu einem Ideal: glatt, kontrolliert, diszipliniert.
Die Glätte der Reinheit
Auch heute trägt jede Rasiererwerbung, jedes „smooth feeling“-Versprechen diese Geschichte in sich – nur sanfter, subtiler, lächelnder.
BIPoC FLINTA werden weiterhin als „zu behaart“ oder „nicht gepflegt“ markiert.
Trans, intersexuelle und nicht-binäre Körper werden pathologisiert, wenn sie nicht in das glattgebügelte Ideal passen.
Und selbst wer sich bewusst entscheidet, sich nicht zu rasieren, bleibt selten unberührt von der Norm.
Ich spüre das, wenn ich in der Sauna sitze oder im Sommer Shorts trage. Gerade in den spanischen Kreisen. Ich weiß, dass meine Körperbehaarung nichts über meinen Wert aussagt – und trotzdem spüre ich manchmal diesen alten Reflex: den inneren Blick der Disziplinierung.
By the way - mein Partner ist davon auch nicht befreit - auch männlich gelesene Körper sind Teil der Geschichte. Neulich sprachen eine Freundin und ich über eine Person, sie sagte: "Sweet but did you see all his hair on his back?” Auch hier gilt: kontrolliert, sportlich, aber nicht „zu wild“. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Ideal erneut verschoben: Auch Männer sollen nun glatte Haut haben.
Das zeigt, wie tief die Verbindung von Haar, Kontrolle und Zivilisationsideologie sitzt. Selbst wenn wir glauben, über solche Normen hinaus zu sein, disziplinieren sie noch immer unsere Körper – auf unterschiedliche Weise, aber mit derselben Logik.
Bis heute: Kontrolle in weichen Farben
Dekolonisierung beginnt im Spiegel
Es geht nicht darum, Haarentfernung zu verurteilen.
Es geht darum, zu verstehen, woher sie kommt – und was sie mit uns macht.
Dekolonisierung heißt, mich zu fragen:
„Rasiere ich, weil ich will – oder weil ich gelernt habe, dass ich soll?"
„Fühle ich mich gepflegt, weil ich es bin – oder weil mir Sauberkeit beigebracht wurde als eine Form der Kontrolle?"
Feminismus heißt für mich: Wahlfreiheit – aber mit Bewusstsein.
Ich darf meine Haare lieben oder entfernen, trimmen oder wachsen lassen, ohne Scham, ohne Rechtfertigung.
Aber ich will wissen, in welcher Geschichte ich stehe, wenn ich den Rasierer in die Hand nehme.
Schlussgedanke
Glätte war nie nur ein Schönheitsideal. Sie war eine Grenze – gezogen entlang von Rasse, Klasse, Geschlecht und Macht. Und sie beginnt sich erst zu lösen, wenn wir erkennen, dass unsere Körper nicht gepflegt, sondern befreit werden wollen.
© 2025. All rights reserved.
*juicy NEWSLETTER
HOLE DIR UNSEREN
Du möchtest R.E.D. Tent zunächst besser kennenlernen?
1x Willkommens-Freebie:
Meditation: „Schärfe deine Wahrnehmung für feine Körpersignale"Impulse zu Körperwissen & Selbstermächtigung
Infos zu Kursen, Webinaren & Events
Persönliche Gedanken & ehrliche Fragen
Und was uns gerade bewegt und inspiriert
und erhalte:
*juicy = Der Begriff kommt aus afro-diasporischen Communities und steht für Sinnlichkeit und Fülle – eine Einladung, Körperfreude jenseits von Leistungslogik zu leben.